In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Georg Schumann eine der prägendsten Gestalten der deutschen Musiklebens – sein mutmaßliches Hauptwerk, das opernhafte Oratorium „Ruth“ (1908), wurde im In- und Ausland begeistert gefeiert. Jörg-Peter Weigle, der das Stück im Jahr 2003 neu entdeckte, zeichnet gut zwei Jahrzehnte später auch für die fulminante Einspielung verantwortlich.
Sie kommen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und sind doch im Leid vereint: Ruth, die ihren Mann verloren hat, und ihre ebenfalls verwitwete Schiegermutter Naomi machen sich gemeinsam auf den Weg, um schweren persönlichen Schicksalsschlägen und der drückenden wirtschaftlichen Not zu begegnen. In der neuen Heimat Israel sind sie zunächst nicht willkommen, doch am Ende gibt es nicht nur für Ruth und Naomi wieder Grund zur Hoffnung. Gott, Natur und Menschen versöhnen sich in einer gewaltigen Apotheose und Schöpfungsfeier.
Ein so hymnisches Finale hält das kleine Buch „Rut“ im Alten Testament nicht bereit. Georg Schumann interessiert sich allerdings auch nur am Rande für die Illustrierung des biblischen Geschehens. Ihm geht es um eine Art Welttheater, das die Kraft der Empathie am Schicksal von hilf- und mittellosen, Ähren aufsammelnden Flüchtlingen erprobt, sich zu einer glühenden Leidenschaft verdichtet und dabei immer mehr Antworten auf die Frage nach dem Sinn und Zweck des menschlichen Daseins findet.
Musikalisch bietet der Komponist alles auf, was das frühe 20. Jahrhundert und die eigene Kreativität zu bieten hat: Wer die ganz große Oper, wuchtige Chorsätze und opulente Gesangslinien mag, wird hier begeistert zuhören – der Zwiegesang, den Ruth und Boaz zu höchster Emphase steigern, ist sicher nicht weniger exaltiert als die Ausbrüche der Straussschen „Salome“, der gegenüber Schumann seine Hauptfigur ironisch als „keusches Weib“ charakterisierte. In knapp zwei Stunden lässt sich aber auch Hauchzart-Patorales, betörend Spätromantisches und sogar Symbiotisches entdecken, wenn traditionelle hebräische Melodien auf abendländische Stimmen und Instrumente treffen.
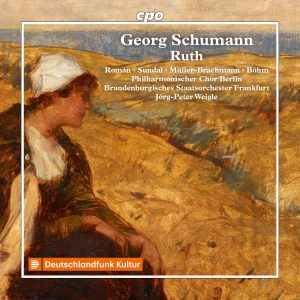
In Schumanns weitverzweigten, schillernden und intensiv leuchtenden Klanglandschaften ist viel Raum, der dem Philharmonischen Chor Berlin Platz für einen eindrucksvollen Auftritt gewährt. Mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt unter dem „Ruth“-Experten Jörg-Peter Weigle gelingt dem Ensemble eine veritable Referenzaufnahme, zu der die vier in ihren Rollen sprichwörtlich aufgehenden Solisten Entscheidendes beitragen. Dass Marcelina Román (Ruth), Julie-Marie Sundal (Naomi), Hanno Müller-Brachmann (Boaz) und Jonas Böhm (Priester) für ihre herausfordernden Partien vielfältige Erfahrungen auf Opernbühnen mitbringen, kommt diesem Genregrenzgänger besonders zugute.
Ein abschließendes Wort zu dem bei cpo gewohnt ansprechenden und umfangreichen Booklet: Gottfried Eberle lässt einer tiefschürfenden Werkeinführung eine nicht minder interessante Rezeptionsgeschichte folgen. Seine Anmerkung, die musikalische Avantgarde hätte in den 1950er Jahren nachgerade die ´Macht ergriffen´ und so einer verdienten Würdigung Georg Schumanns im Weg gestanden, ist gleichwohl ein verbaler Fehlgriff, der historisch entgleist. Schumann war – trotz erkennbarer Distanz zur Ideologie des Dritten Reiches – als Musiker und Komponist, Direktor der Berliner Sing-Akademie (1900-50) oder Präsident der Preußischen Akademie der Künste (1934-45) durchaus Teil des nationalsozialistischen „Kultur“lebens. Eberle selbst zeichnet nach, wie sich der Komponist dem Druck des Goebbels-Ministeriums beugte und 1942/43 einer Neufassung des Oratoriums unter dem Titel „Lied der Treue“ zustimmte, die offenkundig allein dem Zweck diente, die „alttestamentarischen Stellen“ weitestmöglich zu beseitigen. Erst 1946 wurde das Oratorium wieder in seiner ursprünglichen Gestalt aufgeführt.
Unter diesen Umständen kann der musikalischen Avantgarde nach 1945 kaum zum Vorwurf gemacht werden, Georg Schumann (und anderen Kunstschaffenden mit vergleichbaren Biografien) ein ausgeprägtes Distanzgefühl entgegengebracht zu haben. Bis heute und in Zukunft müssen die Brüche in ihrem Leben und Werk Teil der Rezeption sein – wie es im vorliegenden Fall ja durchaus auch geschehen ist.
Georg Schumann: Ruth, 2 CDs, cpo


