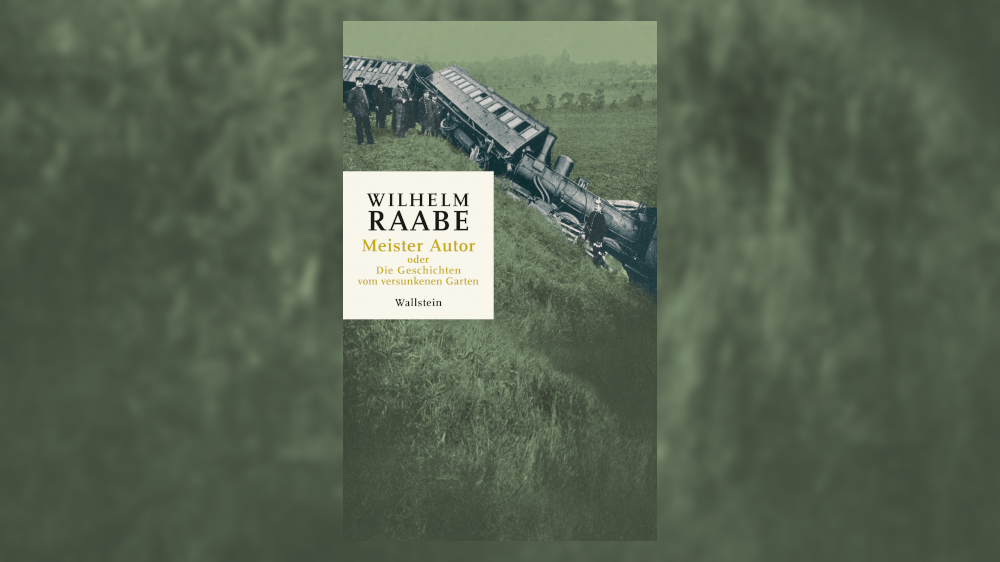Seit 2023 stellt der Wallstein-Verlag wenig bekannte Werke Wilhelm Raabes in aufwändig gestalteten und fachkundig kommentierten kritischen Ausgaben vor. Die jüngste Publikation rückt einen der vielschichtigsten Romane nach langer Zeit wieder ins Rampenlicht. In „Meister Autor oder die Geschichten vom versunkenen Garten“ (1874) gerät eine traditionsverbundene, naturnahe Lebenswelt unter die Räder der Gründerzeit.
Gelegentliche Publikumserfolge waren bei Wilhelm Raabe nie ein Garant für dauerhaften Erfolg. Sein zeit- und gesellschaftskritisches, oft verwinkeltes und multiperspektivisches Erzählen lieferte dem Deutschen Reich wenig seichte Unterhaltung, kaum Rührseliges – und stramm Nationalpolitisches oder gar Ideologisches gab es hier auch nicht zu holen. Der zweite Roman, den Raabe nach seinem Umzug von Stuttgart nach Braunschweig zu Papier brachte, traf auf eine besonders widerwillige Leserschaft. „Weder Publikus noch Publika haben was von meinem ´Meister Autor´ wissen wollen, und die ganze Auflage ist zuletzt zu sechzig Pfennig das Exemplar zu haben gewesen“, notierte der Autor fast 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung.
Dabei beginnt der Roman mit einer Fahrt ins Grüne und endet mit einer doppelten Hochzeit. Als wäre er ein Fall für die „Gartenlaube“. Ist er aber nicht, denn dem Erzähler fällt der Ausflug, dessen Waldromantik in einem „im Quincunx gepflanzten Musterforst“ steckenbleibt, schon nach wenigen Seiten „auf die Nerven“. Und die finalen Eheschließungen haben auch nicht das Zeug zum happy end. Ein aus vager Sympathie und ein paar rationalen Erwägungen gemixtes Arrangement muss für die unsichere Zukunft reichen.
„Siehst du Emil,“ sagte meine kluge Frau, „man glaubt alle Augenblicke vor einer Wand zu stehen, um jedesmal zu finden, daß ein Weg um dieselbe herumführe.“
Was sich auf den rund 150 Seiten zwischen Sommerfrische und beginnendem Eheleben abspielt, schürt freilich nicht die Hoffnung, dass sich die Dinge irgendwann doch zum Guten entwickeln. Der Bruder des Titelhelden, der in Niederländisch-Ostindien auf zwielichtige Weise zu Reichtum gekommene Abenteurer Mynherr van Kunemund, hat der Förstertochter Gertrude Tofote eine Rokokovilla mit Garten vererbt – wohl wissend, dass es sich weniger um ein architekturgeschichtliches Denkmal und ökologisches Refugium als um eine lukrative Geldanlage handelt. Im Rahmen der geplanten Stadterweiterung sollen Villa und Garten einer mit Kanalisation und Gasleitung ausgestatteten „Prioritätenstraße“ weichen und können entsprechend gewinnbringend verkauft werden. Für den Förster Tofote und den passionierten Handwerker Autor Kunemund verschwindet damit ein weiteres Stück ihres traditionsgebundenen, naturnahen Lebensraums. Gertrude aber bedeutet das unverhoffte Erbe die Chance auf einen nicht minder überraschenden sozialen Aufstieg.
Stein der Abnahme oder Apfel des Glückes?
Der Erzähler Emil von Schmidt, der sich als studierter Bergbauingenieur, ehemaliger Staatsdiener und aktuell „beschäftigungsloser Liebhaber wohlfeiler ästhetischer Genüsse“ zu erkennen gibt, beobachtet, beschreibt, zweifelt gleich mehrfach daran, dass ihn die Protagonisten seines Berichts überhaupt irgendetwas angehen und wechselt immer wieder die Seiten. Bisweilen mischt sich Zuversicht, ja sogar Stolz in seine Betrachtungen der Moderne und ihrer beispiellosen technischen Errungenschaften. Dann gewinnt die Sorge vor unwiderbringlichen Verlusten, vor kaum kontrollierbaren Katastrophen wie dem im Roman geschilderten Eisenbahnunfall und das ganze bohrende „Unbehagen in der Zeit“ wieder die Oberhand. Wird der Veränderungszwang in seinem atemberaubenden Tempo wenigstens vor dem absolut Bewahrenswerten haltmachen?
„Wie schön doch die Welt geblieben ist!“ sagte ich erstaunt. „Gütiger Himmel, und das liegt noch immer dicht neben uns, und lächelt uns mitleidig nach, während wir da vorüberrasen, befangen im Wahn in dem wüsten Gelärm durch eigenes Mitlärmen, Mitkeuchen und Mitgreifen das zu gewinnen, woran wir längst vorübergewirbelt wurden.“
Ein kaum beschreib- und katalogisierbares Fundstück in der zum Abriss bestimmten Villa macht die Ambivalenz des unsteten Lebensgefühls sinnfällig. Für den Matrosen Karl Schaake ist das seltsame Objekt ein „Stein der Abnahme“, den – seiner bescheidenen, aber weitgesegelten Meinung nach – kein malayischer Seemann auf seinem Schiff dulden würde. Er wirft den Unglücksboten in den Gartenteich, wo er später gefunden und von einem Professor ins genaue Gegenteil umgedeutet wird. Beweise hat auch der Gelehrte nicht, was seiner festen Überzeugung, dass hier ein „domestikal-hieratischer Zauber“ am Werk und das mutmaßliche Amulett ein „Apfel des Glückes“ sei, aber keinen Abbruch tut.
Ein „europäisch gewitzigter Afrikaner“
Sein Urgroßvater wurde für eine „abgelegte neapolitanische Schiffsleutnantshose“ verkauft, er selbst in Bremen geboren: In Ceretto Meyer lernen die Lesenden nicht nur einen passionierten deutschen Muttersprachler, sondern auch einen empathischen Begleiter und Tröster, abgründigen Philosophen und klugen, wenn auch eigenwilligen Ratgeber kennen. Der dunkelhäutige Diener des verstorbenen Mynherr van Kunemund ist zweifellos die facettenreichste Figur des Romans und eine singuläre Erscheinung in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts.
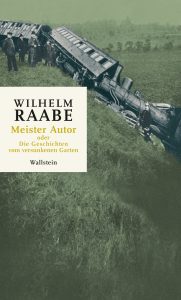
Letzteres auch deshalb, weil es Raabe gelingt, seine fulminante Wirkung auf die weiße, durch und durch bürgerliche und schon im Ansatz fremdenfeindliche Gesellschaft parodistisch zu inszenieren, ohne stereotype Vorurteile zu kultivieren oder diesen „so sehr europäisch gewitzigten Afrikaner“ aus gönnerhafter Perspektive zu betrachten. Selbstredend können Wörter und Begriffe – im Roman ist von „Mohr“, „Neger“, „Nigger“, „Meß- und Jahrmarktsindianer“, „Unthier“, „Ungeheuer“ oder „Teufelsfratze“ die Rede – auch in einem satirischen oder betont wohlwollenden und humanistischen Kontext als rassistisch empfunden werden. Dass Raabes Original beibehalten und nicht mit Sternchen oder euphemistischen Konstruktionen bearbeitet, stattdessen aber sehr eingehend kommentiert wurde, ist im Sinne der Authentizität und einer fundierten historischen Auseinandersetzung gleichwohl nachdrücklich zu begrüßen.
Am Ende des Romans zieht Ceretto mit Emil von Schmidt und seiner frisch angetrauten Gattin nach Berlin, mitten in das Zentrum des Deutsches Reiches, dass seine Identität und Aufgaben gerade neu definiert. Den „dunkelfarbigen Weltweisen“ betrachtet der Erzähler nicht nur als „großen Mann“, sondern auch „als eine Art von gutem Genius“. Das immerhin ist positiv und hoffnungsfroh um die Wand gedacht!
Ein abschließendes Wort zur Neuausgabe, die schon als solche zeigt, dass die Nachwelt „Meister Autor“ freundlicher gegenübersteht als Raabes Zeitgenossen. Raabes experimenteller Schreibstil und seine ebenso frühe wie kritische Auseinandersetzung mit den Schattenseiten des Kapitalismus und der Globalisierung könnten heute tatsächlich mehr Interessenten finden als vor 150 Jahren. Herausgeber Dirk Göttsche hat dafür eine solide neue Grundlage geschaffen, auch wenn trefflich darüber gestritten werden mag, ob die historische Fassung letzter Hand von 1903 besonders leserfreundlich ist, inwiefern die Kommentare etwas schlanker hätten ausfallen können und ob es überhaupt gelingen kann, einen fast vergessenen Roman des 19. Jahrhunderts durch Wiederveröffentlichung und wissenschaftliche Neubetrachtung in eine halbwegs sichtbare Abteilung des literarischen Kanons zu hieven.
Die Geschichten vom versunkenen Garten sind zurück! Zumindest bis die nächste „Prioritätenstraße“ über sie hinweggeht …
Wilhelm Raabe: Meister Autor oder die Geschichten vom versunkenen Garten, Wallstein 26 €