Für Fanny Lewald war in der Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts lange kein Platz. Ihr Leben und Werk fiel einem zielgerichteten Vergessen anheim, das nicht nur auf ästhetischen Fehlurteilen gründete, sondern wohl auch der Absicht entsprang, den herausragenden Beitrag zu schmälern, den eine Frau aus jüdischer Familie zur deutschen Geistesgeschichte geleistet hatte. Die Neuveröffentlichung ihres bahnbrechenden Romans „Jenny“ (1843), der dieser Tage in einer schön gestalteten, von Mirna Funk kommentierten Ausgabe bei Reclam erscheint, ist deshalb von kaum zu überschätzender Bedeutung.
Jenny will alles: das Lebensglück an der Seite eines geliebten Menschen, die vorbehaltlose Anerkennung als Frau und Jüdin und vor allem die Freiheit, Vorurteile und Diskriminierungen zu bekämpfen und sich im Bedarfsfall über politische Rücksichten, religiöse Dogmen und soziale Schranken hinwegzusetzen. Und das alles fordert die junge Frau, die aus einem ebenso fürsorglichen und wohlhabenden wie immer wieder stigmatisierten Elternhaus stammt, nicht als persönliche Vergünstigung, als gönnerhafte Zulassung eines Einzelfalls, sondern als Grund- und Menschenrecht einer modernen Gesellschaft.
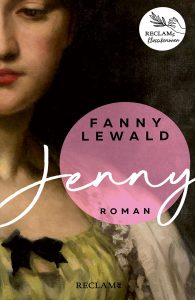
Für das Jahr 1843 war das eindeutig zu viel, auch wenn die schwere revolutionäre Erschütterung der patriarchalischen, christlich dominierten Ständesysteme bereits ihre Schatten voraus warf. Fanny Lewald, die 1829 vom Judentum zum Protestantismus konvertiert war, eine Zweckehe abgelehnt hatte und sich Anfang der 1840er Jahre als freie Schriftstellerin zu etablieren versuchte, gönnt Jenny denn auch keine Rettung in ein alternatives, utopisches Lebensmodell. Die Konflikte zwischen Frauen und Männern, zwischen Juden und Christen, zwischen den durch ihre Geburt Privilegierten und den durch eben diese von jeder Teilhabe Ausgeschlossenen werden in diesem autobiographisch geprägten Roman behutsam entwickelt, aber entschlossen ausgetragen. Als Jenny bei einem Empfang zufällig Zeugin antisemitischer Bemerkungen wird, singt sie das Lied „Das Mädchen von Juda“, das die Tragödie eines geknechteten Volkes erzählt. Nach dieser Darbietung wirkt die Szenerie wie eingefroren:
Kein lautes Zeichen des Beifalls war zu hören, in vieler Augen standen Tränen; andre sahen sich befremdet an. Sie schienen dunkel zu ahnen, dass ihnen hier, wo sie flüchtige Unterhaltung zu finden gehofft, eine Wahrheit entgegengetreten war, vor der sie erschraken, wie vor einem Gespenste, das plötzlich am hellen Tage in die Reihen der Lebenden tritt.
Fanny Lewald zeichnet einen fesselnden Querschnitt durch die Gesellschaft, die selbstredend nicht nur aus emanzipierten Freidenkern wie Jenny, ihrem für die Gleichberechtigung des Judentums kämpfenden Bruder Eduard oder dem edelmütigen, toleranten Grafen Walter besteht – aber eben auch nicht allein aus den ewig Gestrigen, aus überzeugten Antisemiten und verknöcherten Feudalisten, wie sie uns in der Gestalt einer namenlosen, bösartigen Stiftsdame oder des hinterhältigen Baron W. begegnen. Viele Romanfiguren sind Gestalten des Übergangs, verhaftet in alten Weltbildern, bereit, aber noch nicht fähig, sich für ein fortschrittliches Denken zu öffnen – wie Jennys erster Verlobter Gustav Reinhard, der seine Liebe nicht mit seinen religiösen Überzeugungen in Einklang bringen kann, der an Mozarts „Le nozze di Figaro“ leidet, weil er die Oper als ein „schlüpferiges, sittenloses Stück“ empfindet und der überdies zu schwach ist, den Einflüsterungen der Umwelt Entscheidendes entgegenzusetzen. Die Mahnung seiner bigotten Mutter – „Jenny, von den Ihrigen im Zweifel erzogen, ist ein weiblicher Freigeist geworden. Wird sie, die Glaubenslose, dich dauernd glücklich machen können?“ – fällt schließlich auf fruchtbaren Boden.

Was diesen Roman vollends zu einem bedeutenden, lesenswerten und diskussionswürdigen Werk macht, ist Lewalds durchgehender und erfolgreicher Versuch, Handlungen und Einstellungen ihrer Figuren nicht allein auf charakterliche Veranlagungen und Erfahrungswerte, sondern vor allem auf Erziehungsmuster sowie gesellschaftliche und politische Vorprägungen zurückzuführen. Ohne den strukturellen Antisemitismus und die tiefgehende Frauenfeindlichkeit einer Gesellschaft, die mindestens in Teilen auch noch die unsere ist, würde sich der Plot praktisch in Luft auflösen.
Mitunter drückt das Gewicht der behandelten Themen auf den eleganten Plauderton, doch Fanny Lewald findet immer wieder in den Erzählfluss eines Familienromans zurück und wirft schließlich zwei Blicke in eine noch unbestimmte Zukunft. Dort sieht Eduard eine neue Zeit heraufdämmern, in der die „Emanzipation unsers Volkes“ vollendet ist. Die zweite Vision zeichnet Jenny auf ein Blatt Papier, um dem Grafen Walter ihre Vorstellungen von einer gleichberechtigten Partnerschaft vor Augen zu führen.
Sie hatte mit kunstgeübter Hand eine vortreffliche Skizze entworfen. Zwei kräftige, üppige Bäume standen dicht nebeneinander, frisch und fröhlich emporstrebend, mit eng verschlungenen Ästen. Darunter las man die Worte: „Aus gleicher Tiefe, frei und vereint zum Äther empor!“
Fanny Lewald: Jenny, Reclam, 24 €


